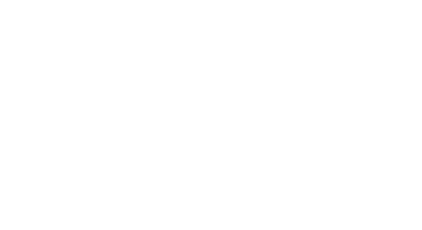Am 8. September beschloss der Bundesrat die Corona-Zertifikatspflicht. Sie gilt unter anderem für Restaurants, Kinos und Fitnessstudios. Am gleichen Tag traten laut dem Bundesamt für Gesundheit 55 coronapositive Patienten in Schweizer Spitäler ein. Zum Vergleich: Jeden Tag nehmen die Akutspitäler im Durchschnitt 4035 Patienten auf.
Auf den Intensivstationen befanden sich am 8. September 292 Patienten wegen Corona, 399 Patienten mit anderen Beschwerden. Total gab es an diesem Tag 168 freie Intensivbetten.
Unklar ist, wie viele der vom Bundesamt mitgeteilten Spitaleinweisungen «von und mit Corona» tatsächlich aufgrund einer Coronainfektion erfolgten. Vom 24. Februar 2020 bis 8. Juni 2021 meldeten die Kantonsärzte dem Bundesamt 28 801 Hospitalisationen im Zusammenhang mit Corona. Aber nur bei 13 108 Patienten gaben die Spitäler auf ihren Meldeformularen Covid-19 als Grund für die Hospitalisation an – also bei 46 Prozent. 16 Prozent kamen aus einem anderen Grund ins Spital, bei 38 Prozent fehlte ein Einweisungsgrund («Saldo» 12/2021).
Hospitalisationen gehen zurück
Im Vergleich zum vergangenen Jahr gehen die Spitaleinweisungen wegen oder mit Corona zurück. 2020 gab es vom Ausbruch der Pandemie bis 13. September 2020 offiziell im Durchschnitt jeden Tag 64 Hospitalisationen – dieses Jahr sind es noch 48. Diese Zahl dürfte aufgrund der steigenden Impfquote weiter sinken. Denn erste Zahlen zeigen, dass Geimpfte die Spitäler weniger belasten als Ungeimpfte («Gesundheitstipp» 9/2021).
Auch die Zahl der an und mit Covid Verstorbenen sinkt. 2020 starben ab Ausbruch der Pandemie jeden Tag im Durchschnitt 25 positiv getestete Menschen – dieses Jahr sind es noch 12. Zum Vergleich: Insgesamt starben 2019 in der Schweiz pro Tag durchschnittlich 186 Menschen. Im vergangenen Jahr waren es 208 – und dieses Jahr bis am 5. September 181.
Covid-19 ist eine Atemwegsinfektion. Trotzdem werden in den Spitälern nicht mehr Patienten mit einer Lungenentzündung behandelt als früher. Die Krankenkasse Sanitas stellt sogar das Gegenteil fest: Der Vergleich zwischen dem zweiten Halbjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 zeigt einen Rückgang der coronabedingten Lungenentzündungen.
Laut dem Unispital Zürich ist die Zahl der stationär behandelten Lungenentzündungen über die Jahre 2019, 2020 und 2021 konstant. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Krankenkasse Groupe Mutuel, wenn man jeweils die ersten fünf Monate der Jahre 2019, 2020 und 2021 vergleicht. Trotz diesen Zahlen behaupten Politiker, die Spitäler seien am Anschlag – und begründen damit Verschärfungen der Coronamassnahmen.
Das Schweizer Gesundheitssystem kostet die Prämienzahler pro Jahr rund 85 Milliarden Franken. Es beschäftigt 71 000 Pflegekräfte und 21 000 Spitalärzte. Den grössten Posten des Budgets machen mit 30 Milliarden die Spitäler aus.
Dieses Gesundheitssystem hat das Coronajahr 2020 gut bewältigt, auch wenn es in bestimmten Bereichen am Limit lief. Das zeigen Zahlen der Helsana, die der «Tages-Anzeiger» veröffentlichte. «Es gab in vielen Bereichen ein Schwarzmalen», sagt dort Helsana- Ökonom Manuel Elmiger. Im Lockdown seien zwar Eingriffe verschoben worden, «in vielen Bereichen wurden aber fast alle wieder aufgeholt». Übers Jahr habe es kaum Schwankungen bei Knie- oder Hüftoperationen gegeben, die als sogenannte Wahleingriffe gelten. Ausgewertet wurden die Daten von 1,4 Millionen Grundversicherten der Helsana.
Viel zu viele unnötige Operationen
Und sollte das Gesundheitssystem doch einmal an den Anschlag kommen, gäbe es Sparpotenzial – bei unnötigen Operationen. Annamaria Müller, Verwaltungsratspräsidentin des Freiburger Spitals, wüsste, wo man den Hebel ansetzen müsste. Sie kennt das System bestens: Die Ökonomin war in der Zürcher Gesundheitsdirektion verantwortlich für Gesundheitsökonomie. Sie arbeitete als Generalsekretärin des Berufsverbands der Ärzte, FMH, und sie war in der Berner Gesundheitsdirektion Vorsteherin des Spitalamts. Müller kritisiert: «Wir haben ein zu einseitig auf Reparaturmedizin ausgerichtetes System.» Die Spitäler würden immer öfter das machen, was rentiere. Und sie sorgten für eine hohe Bettenauslastung.
Bei nicht so gut entschädigten oder defizitären Leistungen stellt Müller oft eine ungenügende Versorgung fest. Schuld seien falsche Anreize des Systems.
Ein Blick in den Versorgungsatlas der Schweiz zeigt, wie unterschiedlich hoch die Zahl gewisser Eingriffe ist. Drei Beispiele:
- Pro 1000 Einwohner wird im Kanton Nidwalden 1,5-mal einem Patienten krankes Gewebe aus Harnblase oder Prostata entfernt – im Thurgau hingegen 3,6-mal.
- Ein Leistenbruch wird in Nidwalden 0,9-mal pro 1000 Einwohner operiert – in Schaffhausen liegt der Wert bei 3,3.
- Wegen eines Meniskusschadens landen in Nidwalden 1,4 pro 1000 Einwohner auf dem Schragen – in Schwyz 6,1.
«Wir haben genug Spitalbetten»
Müller kritisiert, dass die Spitäler heute daran interessiert sind, möglichst viele Behandlungen auszuführen. Sie schlägt vor, dass nicht mehr die einzelne Leistung bezahlt wird, sondern eine Pauschale für die ganze Versorgung eines Patienten mit Vorsorge, Behandlung und Nachbetreuung. Annamaria Müller. «So hätten die Leistungserbringer wie Ärzte oder Spitäler einen Anreiz, eine nachhaltige Behandlung mit Vorsorge, Therapien, allenfalls Eingriffen und Nachbehandlung so günstig wie möglich zu machen.»
Zusätzlich fordert Müller, konsequent von stationären auf ambulante Behandlungen umzustellen. So könnte rund ein Drittel aller Spitäler und Spitalbetten eingespart werden. «Wir haben genug Spitalbetten», sagt sie. «Allerdings müssten die einzelnen Regionen in mehrere Gesundheitszentren und jeweils ein Zentrumsspital mit Spitzenmedizin aufgeteilt werden.» Ihre Begründung: Ältere Patienten haben immer mehr Altersbeschwerden und chronische Krankheiten. Diese Leute brauchen in den meisten Fällen eine langfristig gute Betreuung und keine Spitzenmedizin. Müller: «Heute landet eine 80-jährige Frau mit einer Lungenentzündung im sehr teuren Akutspital, das auf eine 24-Stunden-Betreuung und -Überwachung ausgerichtet ist. Es geht auch anders – ebenso gut und billiger.»