Inhalt
Mitten in der Zeit, in der Bundesrat Berset überfüllte Intensivstationen vorhersagte und andere Schreckensszenarien entwarf, erhalte ich einen Brief der Schweizer Berghilfe – gerichtet an «alle Unterländer, die seit Corona die Berge noch mehr lieben». Dazu gehöre ich nicht. Denn meine Liebe zu den Bergen ist dauerhaft gross – und ziemlich unabhängig von Corona. Aus dem Faltblatt blickt mir nun ein Bergbauer entgegen, die Ärmel nach hinten gekrempelt. Darüber der Titel «Viele Bergbetriebe liegen auf der Intensivstation».
Die Schweizer Berghilfe schlägt Alarm und behauptet: Die Berggebiete seien landesweit am meisten von Corona betroffen. Gefolgt von einem Einzahlungsschein und dem Aufruf: «Gemeinsam mit Ihnen holen wir die Bergler aus dem Tief.»
Auch nach mehrmaligem Lesen erschliesst sich mir nicht, weshalb Berggebiete besonders hart unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie leiden sollen. Laut dem Wirteverband fehlen besonders in städtischen Beizen und Bars die Gäste, und vermehrt in städtischen Hotels fehlen die Touristen. So viele Schweizer wie noch nie verbrachten ihre Ferien und freie Wochenenden in den Bergen. Lebensmittelhändler mit Produkten von Bergbauern machen Rekordumsätze und Alpläden werden bestürmt. Produkte von regionalen Bauern sind gefragt wie noch nie.
Der Spendenaufruf an uns Unterländer wurde in Adliswil ZH – 451 Meter über Meer – verschickt. Dort, in den Zürcher Büros der Berghilfe, scheint die Not überschaubar, wie ich mit einem Blick in den Jahresbericht von Anfang März sehe: Die Stiftung sitzt auf 133 Millionen Franken Reserven. Die Geschäftsleitung hat sich vergangenes Jahr 650 000 Franken ausbezahlt – 170 000 Jahreslohn pro Kopf. Ein Salär, das manch hart arbeitenden Bergbauern wohl in ein mentales Tief stürzen dürfte.
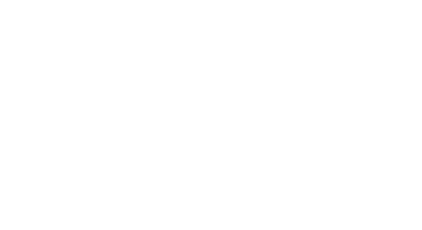



Kommentare zu diesem Artikel
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar hinzuzufügen
Sind Sie bereits Abonnent, dann melden Sie sich bitte an.
Nichtabonnenten können sich kostenlos registrieren.
Besten Dank für Ihre Registration
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Registration.
Selbsthilfe
Jedes "Hilfswerk" hilft sich immer selbst zuerst. Die Berge brauchen keine Hilfe. Wer was braucht, soll sich bei den Kindern von Christoph Blocher melden. Jedes hat im 2020 über 100 Mio Schweizer Franken Dividende kassiert, aus einem Unternehmen, das im Kanton Graubünden liegt. Allegra!
Auf diesen Kommentar antworten:
Quelle
Wer es selbst nachprüfen möchte: siehe "Jahresrechnung und Revisionsbericht 2019", im normalen Jahresbericht 2019 stehen die genannten Zahlen nämlich nicht. https://www.berghilfe.ch/assets/files/publikationen/jahresberichte/jahresrechnung-und-revisionsbericht-2019.pdf Zitat: Für die durchschnittlich 3.8 Vollzeitstellen umfassende Geschäftsleitung (Vorjahr 4 Vollzeitstellen) wurden im Jahr 2019 Saläre von CHF 650’700 (Vorjahr: CHF 689’970) und Beiträge in die Vorsorgewerke der 1. & 2. Säule von CHF 129’399 (Vorjahr 138’207) ausgerichtet
Auf diesen Kommentar antworten:
Wo guckt da ZEWO hin?
In den letzten Ausgaben des Beobachters prangten ganzseitige Inserate der Berghilfe, natürlich versehen mit einem ZEWO-Hinweis. Auch diese Werbung dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Da frage ich mich schon, was neben diesen Werbekosten, der ganzen Administration und den Topgehältern des Kaders von den Spendegeldern für die Leute in den Bergen noch übrig bleibt. Was sind hier die Regeln für ein ZWEO-Label?
Auf diesen Kommentar antworten:
und tschüss ...
das war es mit der Unterstützung der Schweizer Berghilfe !
Auf diesen Kommentar antworten:
Berghilfesaläre geben mir zu denken
Ich unterstütze die Berghilfe seit Jahrzehnten finanziell und ideell. Nach meiner Pensionierung habe ich mich dort als Experte angeboten. Im Landmaschinenbau tätig haben wir Bergbauern auch direkt unterstützt. Wenn ich jetzt aber lese, welch überrissene Saläre sich die Geschäftsführung leistet, so werde ich zukünftig andere Organisationen unterstützen.
Auf diesen Kommentar antworten: