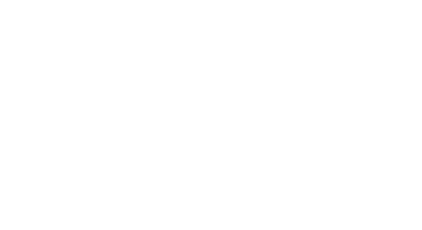Der Verdacht wird immer mal wieder laut: Smartphones würden ihre Besitzer belauschen und anschliessend auf die Gespräche zugeschnittene Werbung zeigen. Das vermutete auch Stefan Manser aus Malters LU: «Ich trank mit Freunden einen alkoholfreien Martini, wir sprachen auch über den Drink. Wenig später tauchte in der Youtube-App Werbung dafür auf.» Manser war überzeugt: Das konnte kein Zufall sein.
Der K-Tipp wollte wissen, ob an dem Verdacht etwas dran ist. Dazu benutzte er zwei iPhones und zwei Android-Geräte und erfand als Besitzerinnen vier fiktive Frauen mit Jahrgang 1988 und diversen Social-Media-Profilen – «Lea», «Nina», «Silvia» und «Sara». Zwei der Smartphones waren über Wochen bei Gesprächen dabei, die sich um bestimmte Stichworte drehten. Die anderen Geräte nicht.
Abhörtheorie lässt sich nicht erhärten
Schlussendlich lieferte die Stichprobe keine Hinweise darauf, dass die Handys Gespräche mithörten und entsprechende Werbung aufschalteten. Zwar tauchte auf den Handys Werbung zu einer in den Gesprächen erwähnten Turnschuhmarke auf – allerdings nicht nur auf den Geräten, die bei den Gesprächen dabei waren. Auch eine Untersuchung der Northeastern University in Boston (USA) zeigte, dass die Abhörtheorie kaum zutreffen dürfte: Wissenschafter werteten die von über 17 000 Apps gesendeten Daten aus. Sie fanden keine heimlich aufgenommenen Audiodateien.
«Freunde» gezielt mit Werbung eingedeckt
Doch welche Erklärung gibt es sonst für die zu den Gesprächen passende Werbung? Die wochenlangen Versuche mit den vier Handys der fiktiven Frauen belegen, dass die grossen US-Internetunternehmen zum Teil gezielt «Freunde» umwerben – indem sie ihnen Inserate zu Produkten zeigen, welche die Frauen zuvor gesucht oder angeschaut hatten. Das heisst: Sie analysieren das Surfverhalten von Benutzern, um deren Bekannte mit Werbung einzudecken.
Für die Stichprobe wurden «Lea», «Nina» und «Sara» auf Internetplattformen wie Facebook, Instagram (gehört zu Facebook) und Youtube (gehört zu Google) miteinander «befreundet» – oder sie folgten sich gegenseitig. «Silvia» dagegen ging keine Freundschaften ein und benutzte auch nicht das gleiche WLAN. Bald zeigte sich: Das Surfverhalten der einzelnen «Freundinnen» hatte auch Einfluss auf die Anzeigen, welche die anderen Benutzerinnen erhielten. Einige Beispiele:
- «Nina» sucht nach Whirlpools und folgt verschiedenen Whirlpoolverkäufern auf Facebook und Instagram. Nach rund einer Woche erhält «Sara» den Vorschlag, die Seite eines Händlers ebenfalls zu abonnieren. Das tut sie nicht – trotzdem folgen in den folgenden Tagen Anzeigen zweier Whirlpool-Händler. Auch «Lea» sieht eine Whirlpool-Werbung.
- «Lea» sucht in Apps nach Ray-Ban-Sonnenbrillen. Sowohl «Sara» als auch «Nina» sehen in den folgenden Tagen mindestens zweimal Ray-Ban-Werbung.
- «Sara» interessiert sich für Handyhüllen aus Bambus. Sie googelt danach und versieht auf Instagram einen Beitrag dazu mit einem Herz. Kurz darauf erscheint die Werbung für Handyhüllen mehr als einmal auch auf den Geräten von «Nina» und «Lea». Einmal taucht sogar ein Angebot explizit für «Freunde» auf. Überschrift: «Sharing is Caring, 50 Prozent auf die 2. Hülle».
- «Silvia», das vierte vom K-Tipp erstellte Social-Media-Profil, ging wie erwähnt keine «Freundschaften» auf Plattformen wie Instagram und Facebook ein. Konsequenz: «Silvia» erhält keine der Werbeanzeigen, welche die drei «Freundinnen» sahen. Und ihre Interessen zeigen sich auch nicht in der Werbung der anderen drei Benutzerinnen.
Was sagen Facebook und Google dazu? Die Internetfirmen beantworten die Fragen des K-Tipp zu den Resultaten der Stichproben nicht.
Internetfirmen sollen Vorgehen offenlegen
Anna Mätzener ist Leiterin der Organisation Algorithm Watch Schweiz. Diese setzt sich dafür ein, dass Algorithmen für eine breite Öffentlichkeit nachvollziehbar werden. Sie sagt: «Die Recherche des K-Tipp belegt, dass Firmen wie Facebook und Google die Daten von Benutzern immer raffinierter auswerten.» Sie findet es «problematisch», dass die angewandten Algorithmen für die Handybenutzer so undurchsichtig sind. Mätzener fordert daher, dass die Internetplattformen Wissenschaftern von Gesetzes wegen Zugang zu den Funktionsweisen der Algorithmen und den verwendeten Daten gewähren müssen. Nur so sei es möglich, die Bevölkerung darüber aufzuklären, was im Hintergrund mit den privaten Daten genau passiert.
Mätzener rät, mit Daten zurückhaltend umzugehen – gerade wenn Drittpersonen betroffen sind: «Man sollte zum Beispiel darauf verzichten, in den Social-Media andere Leute zu markieren» – also in eigenen Beiträgen Links zu Freunden zu setzen.