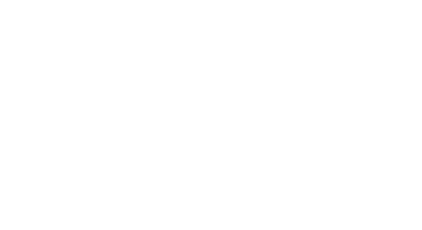Den Tageszeitungen geht es schlecht. Laut der im September publizierten Auswertung der AG für Werbemittelforschung (Wemf) haben besonders die großen Titel Leser verloren: Beim «Blick» waren es im letzten halben Jahr 12 Prozent, bei der «Basler Zeitung» 5,2 Prozent, bei der NZZ 3,9 Prozent und beim «Tages-Anzeiger» 3 Prozent. Weniger Leser bedeuten weniger Einnahmen aus den Inseraten. Denn in der Branche gilt: Die Preise der Anzeigen richten sich direkt nach der Anzahl Leser, nicht etwa nach den Abonnenten.
Eigene Abteilungen für neue Werbeformen
Sinkende Einnahmen pro Inserat sind das eine Problem, weniger Inserate das andere. Deshalb kamen die Verlage auf die Idee, auch den redaktionellen Teil vermehrt an die Werber zu verkaufen – sowohl im Printbereich wie in den digitalen Medien. Dafür schufen sie spezielle Abteilungen, die ausschließlich neue Werbeformen vorantreiben. Sie nennen sich «Commercial Publishing» (Tamedia), «Content Solutions» (NZZ) oder «Brand Studio» («Blick»).
Alle großen Schweizer Verlage setzen dabei auf das sogenannte Native Advertising. Im Klartext ist das Werbung in der Form journalistisch aufgemachter Texte. Journalisten werden zu Werbetextern, Werbetexter zu Journalisten.
Schreiben für Mercedes und Postfinance
Die Native-Advertising-Truppe der Tamedia wird vom langjährigen Journalisten Christian Lüscher geführt.
Er sagte Ende Oktober in einem Interview mit dem Onlineportal «Persönlich» über eine aktuelle Kampagne für Mercedes: «Wir sind keine Werbeagentur. Wir machen nur, wovon wir wirklich etwas verstehen: Inhalte herstellen, die den Leser interessieren.» Im Branchenblatt «Schweizer Journalist» brachte er Beispiele seines täglichen Schaffens: Für die Postfinance etwa, musste er die Leser von «20 Minuten» von den Vorteilen des digitalen Bezahlens per Internet und Smartphone überzeugen. Das Problem: Die Mehrheit der Leser sind Freunde des Bargelds. Lüscher: «Das lieferte uns sinnvolle Ideen für Storys. Man musste die Vorteile von Digitalgeld aufzeigen und Ängste abbauen.»
Allzu viele Werbegeschichten pro Tag liegen nach den Erfahrungen Lüschers nicht drin: «Sonst reagieren Leser erfahrungsgemäß gereizt.» In Leserkommentaren sei dann von Schleichwerbung die Rede. Das sei falsch, denn die Artikel würden deklariert.
Das ist nur die halbe Wahrheit. saldo weiß von Zeitschriften und Newsportalen, die sich dafür zahlen lassen, dass zum Beispiel in einem positiven Artikel über Versicherungen bestimmte Konzernnamen oder Marken genannt werden. Eine weitere Masche: Als «Verlagsbeilagen» bezeichnete Zeitungsbünde, bei denen sowohl Inserate wie redaktioneller Teil bezahlt sind.
Auf Zeitungs- und Zeitschriftenseiten oder im Internet finden Leser mit sehr guten Augen auch immer wieder Deklarationen in Kleinstschrift wie etwa «sponsored content», «powered by» oder «in Zusammenarbeit mit» (siehe abgebildete Beispiele).
Zu den schärfsten Kritikern dieses «gekauften Journalismus» gehört der Medienwissenschafter Vinzenz Wyss. Sein Vorwurf: Ein Teil der Medien prostituiere sich und untergrabe damit die Glaubwürdigkeit aller Medien. Überdies widerspreche intransparentes Native Advertising dem Journalistenkodex. Er hält fest: «Journalistinnen und Journalisten vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit jede Form von kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen von Seiten der Inserenten.»
Beispiel «Finanz und Wirtschaft»
Das Finanzblatt verkauft seinen Inserenten ein sogenanntes «integriertes Werbeformat». In der Broschüre für potenzielle Kunden heißt es: «Diese Anzeige – einer Publire- portage nicht unähnlich – ist nicht auf den ersten Blick als Werbung erkennbar.» Beispiel: Ein Artikel über den «europäischen Finanzsektor», stammt nicht von einem Journalisten, sondern von der US-Bank J.P. Morgan. Das steht nur in Kleinstschrift: «Sponsored by J.P. Morgan» (siehe Pfeil im PDF).
Beispiel NZZ
Am 8. Oktober 2016 verkaufte die NZZ erstmals in ihrer Geschichte die Frontseite einem Inserenten – dem Autohersteller Porsche. Wer der Urheber dieser Zeile ist und dass es sich um Werbung handelt, wird nicht ersichtlich. Trotzdem sagt NZZ-Verlagschef Steven Neubauer: «Die Werbung war als solche deutlich erkennbar.» Sie habe den Zeitungsinhalt nicht beeinträchtigt. Tatsächlich? Der Porsche Panamera war in der NZZ zwischen Mai und September siebenmal Thema. Tenor: Eine «Luxuslimousine auf der Überholspur».
Beispiel «Blick.ch»
Auf der Homepage von Blick.ch ist mitten im redaktionellen Teil das Banner «Coop – Taten statt Worte: Bienen kriegen unsere Hilfe» platziert. Nur in Minischrift am rechten Bildrand kann man lesen: «Sponsored Content» (siehe Pfeil im PDF). Klickt man auf das Banner, wird man zu einer Reihe von journalistisch aufgemachten Artikeln geführt, die im Kern Coop-Produkte bewerben. Beispiel: Beim Text «Unverfälschtes Entlebuch» wird Bio-Schafsmilch beworben, die man in den Coop-Filialen kaufen kann.
Beispiel «Watson»
Beim Onlineportal «Watson» sind die gesponserten Artikel zumindest klar deklariert. Beispiel: Ein Artikel über «das Schweizer Nationalgericht Fondue», «präsentiert von Coop» (siehe Pfeil im PDF). Problematisch ist, dass keine Trennung zwischen Werbung und Journalismus existiert: Der Artikel erscheint im redaktionellen Raum, der Autor des gekauften Fondue-Artikels schreibt auch normale Artikel. Bei «Watson» macht Native Advertising laut eigenen Angaben etwa einen Drittel des Umsatzes aus – Tendenz steigend.