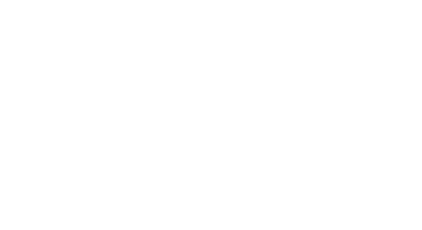Jahrzehntelang war die Luft im unteren Misox in Graubünden stark verschmutzt. Im Jahr 2008 etwa lag die Feinstaubbelastung in der Gemeinde San Vittorio an insgesamt 60 Tagen über dem Grenzwert. Dies besonders in der kalten Jahreszeit, wenn die alten Holzöfen auf Hochbetrieb liefen.
Das kantonale Amt für Natur und Umwelt lancierte deshalb einen Aktionsplan. Es beriet die Bevölkerung, um die gesundheitsschädlichen Emissionen durch richtiges Einfeuern zu reduzieren. Wer seine alte Holzheizung durch eine moderne ersetzte, erhielt einen Zustupf vom Kanton. Das Resultat kann sich sehen lassen: Heute können die Feinstaubgrenzwerte eingehalten werden.
Cheminées sind Feinstaubschleudern
Heizen mit Holz ist zwar grundsätzlich umweltschonender als das Verbrennen von Öl. Doch auch in modernen Holzöfen bilden sich Feinstaub und giftige Abgase wie Kohlenmonoxid, Stickoxide, Schwermetalle und Schwefeldioxid. Rund 10 bis 30 Prozent des jährlich vom Menschen verursachten Feinstaubs weltweit würden aus Holzheizungen stammen, sagt Thomas Nussbaumer, Professor an der Hochschule Luzern. Er ortet bei den ungefähr 539 000 Cheminées und Öfen in der Schweiz Handlungsbedarf: «Viele kleine Feuerungen verbrennen das Holz nicht vollständig. Dabei entstehen Russ und Feinstaub mit einer Grösse von 10 Mikrometern, sogenannte PM10.»
An einer internationalen Fachtagung der ETH forderte Nussbaumer bereits vor Jahren technische Verbesserungen, «um das vollständige Verbrennen von Holz zu ermöglichen». Ausserdem müssten die «Betreiber der Öfen geschult und der Feinstaubausstoss konsequent kontrolliert werden», sagt Nussbaumer.
Die Zahlen geben ihm recht. Während eine Ölheizung 22 Milligramm Feinstaub pro Kilowattstunde (kWh) ausstösst, sind es bei Cheminées und Schwedenöfen massiv mehr: 382 mg/kWh. Dabei liesse sich der Ausstoss von Feinstaub und giftigen Abgasen mit einfachen Mittlen reduzieren:
- Nur unbehandeltes Holz verbrennen: keine lackierten, beschichteten oder imprägnierten Abschnitte oder Balken sowie kein verleimtes Holz oder Spanplatten verfeuern.
- Nur mit trockenem Holz heizen: Nasses Holz verbrennt schlecht und entwickelt viel Rauch. Auch Holz, das trocken wirkt, kann zu feucht für den Ofen sein. Die Holzfeuchtigkeit lässt sich mit speziellen Messgeräten kontrollieren. Die Geräte sind ab 25 Franken erhältlich. Bei 15 bis 20 Prozent Restfeuchtigkeit verbrennt Holz am saubersten und erzielt auch die grösste Heizleistung.
- Richtig anfeuern: Wer Feuer ohne grosse Rauchentwicklung in Gang bringt, schadet der Umwelt weniger. Das Feuer sollte auf dem Holzstapel entfacht werden und von oben nach unten abbrennen. So entsteht deutlich weniger Rauch. Eine genaue Anleitung ist unter anderem auf der Website Lungenliga.ch zu finden.
- Kein kaltes Holz verwenden: Vor dem Gebrauch sollte man das Kaminholz einen Tag lang in einem beheizten Raum lagern. Denn kaltes Holz brennt schlechter ab und russt mehr.
- Genug Luft zuführen: Schlechte Luftzufuhr im Ofen hat eine unvollständige Verbrennung des Holzes zur Folge. So entstehen Russpartikel, Kohlenmonoxid, Methangas, hochgiftige Dioxine und Furane. Wer Luft von aussen in den Ofen zuführt, stellt eine genügende Luftzufuhr sicher.
Auch die richtige Dimensionierung eines Ofens spart Holz und verursacht weniger Feinstaub. Die Heizleistung von Öfen wird in Kilowatt (kW) gemessen und der Energieverbrauch wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben.
Wer einen Schwedenofen als zusätzliche pWärmequelle verwendet, muss dessen Heizleistung mit jener der Hauptheizung abstimmen.
Die Werte variieren je nach Isolation stark: «Ältere Einfamilienhäuser ohne wirkungsvolle Isolation haben einen Heizwärmebedarf von 200kWh/m2 und mehr», erklärt Fachmann Robert Minovsky von der Geschäftsstelle Minergie. Viele Einfamilienhäuser mit Baujahr 1990 lägen zwischen rund 60 und 120 kWh/m2, die allermeisten zwischen 70 und 90kWh/m2. Minergiegebäude dagegen haben einen markant tieferen Heizenergiebedarf: Ohne Warmwasseraufbereitung benötigt ein Einfamilienhaus zwischen 15 und 50 kWh/m2. In Mehrfamilienhäusern mit Minergiestandard geht es gemäss Minovsky «mit 10 bis 45 kWh/m2 noch sparsamer».
Energiespezialist hilft beim Sparen
Wer seinen Ofen zum Heizen benutzen will, sollte einen Energieplaner engagieren, um den Wärmebedarf zu bestimmen. Denn zu grosse Öfen heizen den Raum zu stark auf, verbrauchen zu viel Holz und sorgen für ein ungemütliches Raumklima.
Dabei ist mit Grösse nicht die Dimension des Ofens gemeint, sondern dessen Leistung in Kilowatt. Ein Beispiel: Für ein 40 Quadratmeter grosses Wohnzimmer reicht in einem Haus mit guter Isolation ein sehr kleiner Kaminofen mit nur 1 Kilowatt Leistung. In einem schlecht isolierten Haus sollte der Ofen drei Mal so viel leisten – also rund 3 Kilowatt.
Tipp: Der Branchenverband Holzenergie Schweiz vergibt Qualitätssiegel. Geprüfte Öfen halten nicht nur die Grenzwerte für CO2- und Staubemissionswerte ein, sondern haben auch einen Mindestwirkungsgrad. Auf Holzenergie.ch wird eine Liste geprüfter Produkte laufend aktualisiert. Wer sich einen neuen Kaminofen zulegt, muss keinen zusätzlichen Feinstaubfilter montieren, da moderne Öfen alle Grenzwerte einhalten sollten.
Vor- und Nachteile der verschiedenen Ofensysteme
Schwedenöfen: Wenig effizient
Schwedenöfen sind vergleichsweise günstig. Sie kosten zwischen 1500 und 4500 Franken. Die Metallöfen haben aber einen grossen Nachteil: Ist das Feuer erloschen, ist auch die Wärme rasch weg, weil der Ofen sie nicht speichern kann. Mit der gleichen Menge Holz kann in Speckstein- oder Kachelöfen viel mehr Wärme erzeugt werden.
Specksteinöfen: Wärmen lange
Diese Ofenart ist mit Speckstein verkleidet und speichert die Wärme besser als normale Öfen. Specksteinöfen gibt es in verschiedenen Grössen und Preisklassen ab 5000 Franken. Besonders effizient sind Öfen mit zusätzlichen Speichersteinen im Inneren: Sie strahlen bis zu 24 Stunden lang Wärme ab. Nachteil: Es dauert eine Stunde, bis sie gut wärmen. Und: Öfen mit Speichersteinen sind bis zu 500 Kilo schwer.
Kachelöfen: Für Holz und Pellets
Auch Kachelöfen sind schwer. Man kann sie wahlweise mit Pellets oder Stückholz betreiben. Punkto Wärmespeicherung sind diese Öfen eine sehr gute Wahl. Neben ihrer hohen Speichermasse haben sie zudem Warmluftkanäle. Ein modernes Modell mittlerer Grösse kostet zwischen 10 000 und 20 000 Franken und wird vom Ofenbauer installiert.
Wertvoller Brennstoff
- Ein Raummeter Holz (Ster) entspricht einem Kubus von 1 auf 1 auf 1 Meter geschichteter Holzscheite. Den höchsten Brennwert haben Harthölzer wie Eiche, Buche, Robinie und Esche mit 2100 kWh/Ster. Weichhölzer wie Tanne, Weide und Pappel speichern mit 1400 kWh pro Ster rund einen Drittel weniger Energie. Vergleicht man die gespeicherte Energie von Buchenholz oder Holzschnitzeln (4 bis 5 kWh/kg) mit dem Brennwert von Heizöl extraleicht (12 kWh/kg), wird klar, warum Öl als Brennstoff lange sehr attraktiv war.
- Bäume binden ein Leben lang Kohlenstoffdioxid, indem sie das Klimagas durch Fotosynthese zu Holz machen. Holz ist nichts anderes als über viele Jahre hinweg gespeicherte Sonnenenergie. Beim Verbrennen wird diese gebundene Energie als Wärme freigesetzt.
- In Schweizer Wäldern wächst deutlich mehr Holz nach, als gefällt wird. Thomas Nussbaumer, Professor an der Hochschule Luzern, sagt: «Energieholz deckt fünf Prozent des Gesamtenergieverbrauchs der Schweiz. Dieser Anteil könnte auf acht Prozent erhöht werden.»