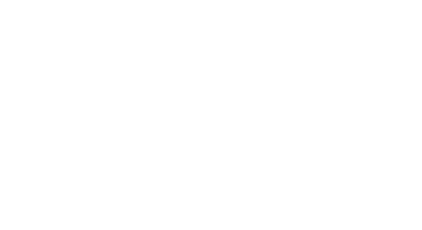Julia Thommsens (Name geändert) Leidenschaft ist ihr Garten. 30 Jahre lang hat sie in Genf das Unkraut mit Roundup bekämpft, einem Pestizid mit dem Wirkstoff Glyphosat. Alle paar Wochen verspritzte sie die Chemikalie. «Das war der schnellste, billigste und wirksamste Weg zur Unkrautbekämpfung.» Zum Schutz habe sie Stiefel, Handschuhe und Gesichtsmaske getragen.
Dass ihre Gesundheit deswegen Mitte 50 ruiniert sein würde, hätte Thommsen nie für möglich gehalten. Sie hat Krebs im Endstadium, ein Non-Hodgkin-Lymphom, das ihr Lymphsystem angreift. Obwohl sie stets auf ihre Gesundheit achtete, nicht raucht und andere Risikofaktoren ausgeschlossen werden können.
Julia Thommsens Verdacht: Ihre Krebserkrankung hängt mit dem regelmässigen Gebrauch des Pestizids zusammen. Der Verdacht ist gut begründet: Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Roundup respektive den Stoff Glyphosat als «wahrscheinlich krebserregend» ein. Mehrere wissenschaftliche Studien belegen: Wer diesem Gift immer wieder ausgesetzt ist, hat ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko, am Non-Hodgkin-Lymphom zu erkranken – also genau an der Krebsart, an welcher Thommsen erkrankte.
Trotz dem Befund der Wissenschaft ist das Pestizid Glyphosat nach wie vor für jedermann frei erhältlich und weltweit der meistverkaufte Unkrautvernichter – auch in der Schweiz.
Bund sieht kein Risiko in Glyphosat
Die Zulassungsbehörde des Bundes sowie der Bundesrat sehen in Glyphosat bei vorschriftsgemässer Anwendung kein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung. Anders beurteilte das ein amerikanisches Gericht im vergangenen Jahr: Es sprach den deutschen Hersteller Bayer wegen Krebsrisiken durch Glyphosat für schuldig und verurteilte den Konzern zu einer Schadenersatz-Zahlung in Millionenhöhe.
Auch Julia Thommsen verklagt den Hersteller des Giftes in den USA auf Schadenersatz. Sie will verhindern, dass sich künftige Generationen, unwissend wie sie, mit Pestiziden vergiften. «Diese Gefahr ist real», sagt die krebskranke Frau, «auch hier in der Schweiz.»
Weder mit Gerichten noch mit untätigen Behörden herumschlagen will sich Winzer Jean-Denis Perrochet. Er verzichtet schon lange auf chemisch-synthetische Pestizide. Er produziert seinen Wein am Neuenburgersee biologisch-dynamisch. Schmerzlich musste er aber in den letzten zehn Jahren miterleben, wie drei seiner Berufskollegen am Neuenburgersee frühzeitig an Bauchspeicheldrüsenkrebs starben. Zwei waren Rebmeister eines Grossbetriebes. Sie verbrachten viel Arbeitszeit auf dem Traktor mit dem Versprühen von giftigen Substanzen. Perrochet ist überzeugt, dass die Pestizide beim Tod seiner Kollegen eine Rolle spielten.
Zurzeit verdichten sich die wissenschaftlichen Hinweise, dass Pestizide nicht nur die Bauern, sondern auch die Wohnbevölkerung gefährden. Eine im April erschienene Studie der Universität Genf zeigt, dass hormonaktive Pestizide vermutlich über Rückstände in den Nahrungsmitteln zu Fruchtbarkeitsproblemen bei Menschen führen.
Viele Parkinson-Fälle im Kanton Wallis
Der im Wallis tätige Neurologe Sitthided Reymond sagt gegenüber dem K-Tipp: «Wahrscheinlich wird die Zahl der von Pestiziden verursachten Krankheiten unterschätzt.» Reymond war 14 Jahre in den Kantonsspitälern Genf, Lausanne, Lugano und Sitten als Arzt tätig und führt jetzt in Sitten eine eigene Arztpraxis.
Als Neurologe fiel Reymond auf: Menschen, die sehr früh, noch vor dem 50. Lebensjahr, an Parkinson erkranken, stammen auffällig oft aus dem Wallis. Zudem leiden laut dem Spezialisten sehr viele Leute in diesem Kanton an chronischer Müdigkeit, Migräne, Muskelschmerzen, an nervösen sensorischen oder motorischen Störungen. Viele beklagen sich über den Sprühnebel von Pestiziden in der Nähe ihrer Häuser, verursacht von den Hubschraubern in den nahe gelegenen Weinbergen und Obstgärten. Arzt Reymond wollte mehr wissen und liess das Blut von 33 Patienten auf Pestizide testen, weil andere Risikofaktoren wegfielen. Die Resultate waren erschreckend: «Alle erkrankten Patienten waren mit einem regelrechten Cocktail aus giftigen Pestiziden belastet.»
Reymond wandte sich mit seinen Ergebnissen an Kantonsarzt Christian Ambord, damit weitere Abklärungen getroffen werden. Doch der Kanton Wallis bleibt untätig. Ambord schreibt auf Anfrage des K-Tipp: «Die Auswirkungen dieser Substanzen (Pestizide) muss durch wissenschaftliche Studien auf überregionaler oder nationaler Ebene geklärt werden.»
Diese Aussage erstaunt: In den USA belegen Forscher immer deutlicher das Gefahrenpotenzial, das von Pestiziden für die Bevölkerung ausgeht. So hat ein Ärzteteam in Kalifornien vor zwei Jahren herausgefunden, dass viele Parkinson-Erkrankte in unmittelbarer Nähe von Gemüseäckern wohnen, die mit bestimmten Pestiziden behandelt wurden. Bei den Pestiziden Paraquat und Mancozeb konnten die Wissenschafter mit Sicherheit sagen, dass sie das Risiko für Parkinson erhöhen. Mancozeb gehört in der Schweiz zu den fünf meistversprühten Pestiziden.
Schweizer Behörden erfassen keine Daten, um solche Zusammenhänge zu erkennen. Diesen Mangel stellte 2017 auch eine Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft fest. Geändert hat sich bis heute nichts.
Erhöhtes Risiko für Hirnkrebs bei Kindern
Der K-Tipp berichtete vor einem Jahr über eine Studie der Uni Bern: Sie stellte ein erhöhtes Hirnkrebs-Risiko bei Kindern in gewissen Regionen fest. Auffällig: Dort wird intensive Landwirtschaft mit Pestizid-Einsatz betrieben (K-Tipp 15/2020). Das Autorenteam versprach neue Erkenntnisse bis diesen Frühling. Noch heute liegen keine Resultate vor, wie eine Anfrage des K-Tipp ergibt.
In der gleichen Zeit wiesen Wissenschafter von kalifornischen Universitäten und Spitälern genau dieses erhöhte Hirnkrebs-Risiko für Kinder hieb- und stichfest nach. Deren Anfang April publizierte Studie zeigt: Ist eine Mutter während ihrer Schwangerschaft gewissen Pestiziden ausgesetzt, weil sie in der Nähe von besprühten Feldern wohnt, steigt das Hirnkrebs-Risiko für ihr Kind um das 2,5-Fache an.
Neu noch umfassendere Recherchen
Der K-Tipp zitiert nicht einfach, was andere sagen, er sucht nach unabhängigen Quellen, deckt Hintergründe und Abhängigkeiten auf und nennt die Verantwortlichen beim Namen. Das ist arbeitsintensiv. Deshalb rüstete die Redaktion letztes Jahr auf. Dank grösserem Rechercheteam konnte der K-Tipp in früheren Artikeln etwa die engen Verflechtungen von Schweizer Behörden mit Pestizide produzierenden Firmen aufdecken.