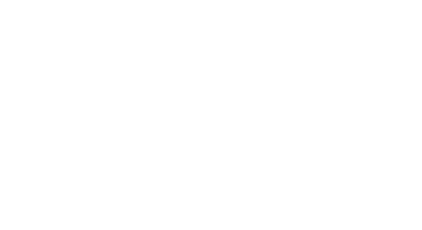Bund und Kantone erhielten in den letzten Jahren von der Nationalbank jeweils bis zu 6 Milliarden Franken. Dieses Jahr geht die öffentliche Hand leer aus. Dafür dürfte man sich in den Chefetagen vieler Banken die Hände reiben. Denn diese erhalten erstmals Zins auf ihren Guthaben auf den Konten der Nationalbank. Dort lagen Ende 2022 rund 540 Milliarden der Banken.
Diese riesigen Guthaben resultierten aus dem Bestreben der Nationalbank, den Franken zu schwächen und so die Exportwirtschaft und den Tourismus zu stützen. Die Nationalbank kaufte zu diesem Zweck den Banken über Jahre hinweg gewaltige Mengen an ausländischen Währungen ab. Der entsprechende Betrag in Franken floss in die Guthaben der Banken bei der Nationalbank.
Im vergangenen September fällte die Nationalbank einen brisanten Entscheid: Sie beschloss, den Banken auf den grössten Teil ihrer Guthaben einen Zins in der Höhe des Leitzinses zu zahlen. Das ist ein Novum, auf diesen Guthaben gab es zuvor nie Zins.
Zinsertrag dürfte in die Milliarden gehen
Mitte Dezember erhöhte die Nationalbank den Leitzins auf 1 Prozent. Die Banken erhalten seither auf den Hauptteil ihrer Guthaben 1 Prozent Zins, auf den Rest 0,5 Prozent. Bleiben die Guthaben der Banken auf ihren Konten bei der Nationalbank ungefähr auf dem aktuellen Stand, dürfen die Geldinstitute im laufenden Jahr mit einem Zinsertrag von mehr als fünf Milliarden Franken rechnen.
Kritiker sehen in den Zinszahlungen der Nationalbank vor allem eines: eine Subventionierung der Banken. Die «NZZ am Sonntag» schrieb pointiert von «Gratis-Milliarden». Sie fliessen ausgerechnet jetzt, wo die Nationalbank erstmals seit 2013 keine Ausschüttungen an Bund und Kantone vornimmt.
Eine solche Ausschüttung gibt es von Gesetzes wegen nur, wenn die Nationalbank ihr Geschäftsjahr mit einem Bilanzgewinn abschliesst. Doch im letzten Jahr schrieb sie einen Bilanzverlust von rund 39 Milliarden Franken. Ihr Eigenkapital beträgt aber noch immer 66 Milliarden.
Basler und Genfer Wirtschaftsprofessoren schreiben in einem Bericht des «SNB Observatorium», bei einem solchen Eigenkapital würde eine Ausschüttung von 6 Milliarden an Bund und Kantone «keinen wesentlichen Unterschied machen». Die Experten kritisieren, dass die Nationalbank nicht die Rückstellungen für Währungsschwankungen zur Deckung des Defizits von 2022 beizieht, die Ende 2021 96 Milliarden betrugen: «Dies entbehrt jeder wirtschaftlichen und finanziellen Logik.»
Die Nationalbank will den Milliardenzins an die Banken nicht als «Subvention» verstanden wissen. Sie schreibt, die Verzinsung der Guthaben sei unter den aktuellen Geldmarktbedingungen das wirksamste Mittel, um den Leitzins am Markt rasch durchzusetzen und so das Zinsniveau generell ansteigen zu lassen.
«Banken nutzen Trägheit der Kunden aus»
Von den Milliarden der Nationalbank geben die Banken kaum etwas an ihre Kunden weiter. Sie zahlen nach wie vor nur tiefe oder gar keine Sparzinsen. Nur einzelne Banken vergüten auf den Sparkonten mehr als mickrige 0,25 Prozent Zins. Und über 0,5 Prozent Zins gibt es fast nirgends.
Im Vergleich zum Zins, den die Banken von der Nationalbank erhalten, ist das deutlich weniger –und bei weitem nicht genug, um die Teuerung von zurzeit knapp 3 Prozent auszugleichen. Das heisst: Die Sparer werden ärmer, denn ihr Geld auf dem Konto ist immer weniger wert.
Adriel Jost, Ökonom und Experte für Geldpolitik, zeigt sich von den weiterhin tiefen Sparzinsen nicht überrascht: «Die Banken nutzen die Trägheit ihrer Kunden aus.» Sie wüssten, dass kaum jemand wegen geringer Zinsdifferenzen den Aufwand auf sich nehme, die Bank zu wechseln.
Doch ohne Druck der Kunden entstehe kein wirklicher Wettbewerb, sagt Jost: «Die Banken haben darum wenig Veranlassung, die Sparzinsen zu erhöhen. Sie können stattdessen mit den Einnahmen aus der Verzinsung ihrer Guthaben ihre Margen und Gewinne aufbessern.»
«Jetzt müssen die Gebühren sinken»
Für Bankkunden führte die Ära der Negativzinsen dazu, dass sich Sparen nicht mehr lohnte. Der Zins blieb aus. Und zusätzlich stiegen die Gebühren der Banken in dieser Zeit kräftig. Das bestätigt eine Untersuchung des Preisüberwachers vom Sommer 2022. Demnach gaben die Banken als Begründung für Gebührenerhöhungen oft an, sie wollten damit «dem anhaltenden Rückgang ihrer Zinsmargen entgegenwirken». Der Preisüberwacher stellte klar: «Wir erwarten, dass die Banken die in Rechnung gestellten Gebühren senken werden, sobald sich die Zinssituation normalisiert hat.»
Dafür wäre jetzt die Zeit gekommen. Das sieht auch Ökonom Adriel Jost so: «Die Banken machen zurzeit ein gutes Geschäft: Sie erhalten von der Nationalbank grosse Zinszahlungen. Sie verzinsen aber die Spareinlagen der Kunden kaum. Und sie erhöhten viele Gebühren und kamen so zu zusätzlichen Einnahmen. Zumindest die Gebühren müssten nach der Rückkehr zu positiven Leitzinsen wieder sinken.»