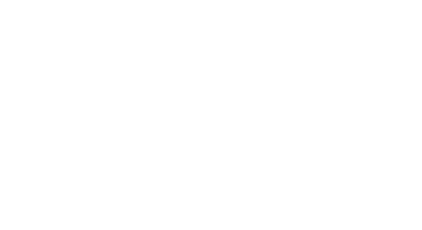In einer neuen Studie ihres Bundesamts wird behauptet, jeder neue Rentner habe zu wenig Kapital gespart, um seine Rente zu finanzieren. So entstünde für die Pensionskassen ein «Pensionierungsverlust». Die Studie (siehe Box) basiert auf gerade einmal 27 der rund 2000 Pensionskassen. Ist das seriös?
Colette Nova: Es handelt sich deklariertermassen um eine nicht repräsentative Studie. Es werden immer wieder Schätzungen zu den Pensionierungsverlusten gemacht. Jüngst wurde zum Beispiel die Zahl 3,5 Milliarden Franken genannt. Niemand kennt genaue Zahlen, weil niemand die Daten aller Kassen erhoben hat. Diese Schätzungen halten wir deshalb für nicht korrekt. Mit unserer Studie wollten wir gar nicht den Gesamtbetrag der Pensionierungskosten eruieren, sondern exemplarisch anhand von 27 Kassen aufzeigen, welche Mechanismen zu diesen Pensionierungsverlusten führen.
Das Resultat Ihrer Auftragsstudie bezweifeln Sie trotzdem nicht?
Die Zahlen stimmen für die 27 Kassen. Dort gibt es die ausgewiesenen Pensionierungsverluste. Das heisst, die Angestellten müssen für die Pensionierten bezahlen. Diese Querfinanzierung ist nicht im Sinne des Pensionskassensystems.
Die Studie übernimmt einfach die Angaben der Kassen zu Rückstellungen für «Pensionierungsverluste». Doch die basieren nicht auf Fakten, sondern auf Prognosen. Trotzdem spricht die Studie von tatsächlichen Verlusten.
Sobald das Altersguthaben in eine Rente umgewandelt wird, gibt die Pensionskasse ein Versprechen für die Zukunft ab: Sie muss in den nächsten über 20 Jahren eine bestimmte Rente auszahlen. Deshalb muss sie die Kosten dafür kennen, sonst kann sie die Finanzierung nicht sicherstellen. Dazu muss die Pensionskasse Annahmen über die Zukunft treffen. Sie muss dabei nach dem Vorsichtsprinzip vorgehen, das «Prinzip Hoffnung» ist nicht zukunftstauglich.
Warum hat die Studie nicht untersucht, ob die Rückstellungen der ausgewählten Kassen für «Pensionierungsverluste» realistisch sind?
Diese Rückstellungen sind nach anerkannten Standards berechnet worden und sind realistisch.
Die Autoren der Studie hätten doch mindestens die durchschnittliche Lebenserwartung der Versicherten erfragen müssen, um die Rückstellungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen?
Wenn heute Versicherte pensioniert werden, wissen wir, dass ihre durchschnittliche Lebenserwartung während ihrer Pensionierung noch weiter ansteigt. Würde die Kasse ihre Rückstellungen nur auf die aktuelle Lebenserwartung ausrichten, dann würden sie nicht ausreichen, um die Renten bis ans Lebensende zu finanzieren. Deshalb muss der Anstieg der Lebenserwartung mitberücksichtigt werden.
Laut den offiziellen Zahlen des Bundesamts für Statistik steigt die Lebenserwartung der Schweizer in den letzten Jahren nicht mehr, jene der Frauen sank sogar leicht. Woher wissen Sie, dass die Lebenserwartung der Rentner zunimmt?
Die Lebenserwartung der allgemeinen Bevölkerung ist nicht mit der Lebenserwartung der Berufstätigen identisch. Die Erwerbstätigen werden im Durchschnitt älter. Deshalb brauchen die Kassen Lebenserwartungszahlen, die nur die Berufstätigen abdecken.
Jede Pensionskasse weiss, wie alt ihre Rentner bisher wurden. Trotzdem nehmen Sie als Basis ihrer Berechnungen andere Zahlen: Die Pensionskasse einer Gastronomiekette rechnet zum Beispiel mit den Lebenserwartungszahlen von Beamten- und Grossunternehmenskassen. Doch das Servicepersonal lebt im Durchschnitt weniger lang. Folge: Die Rückstellungen sind zu hoch, die angeblichen «Pensionierungsverluste» fiktiv.
Damit die Pensionskassen verlässliche Zahlen zur Lebenserwartung erhalten, brauchen sie eine grosse Grundgesamtheit. Eine Kasse mit bloss 1000 Mitgliedern darf nicht einfach nur auf ihre eigenen Pensionierten abstellen, das wäre zu unsicher. Sie benötigt Zahlen einer grösseren Gruppe. Allerdings kann und soll sie die Erfahrungen mit ihren eigenen Pensionierten bei der Festlegung des Bedarfs an Rückstellungen mitberücksichtigen.
Je höher die Rendite auf dem Alterskapital der Rentner, desto länger reicht das Geld. Deshalb hätten die Autoren der Studie doch auch die tatsächliche Rendite des Alterskapitals der Rentner in die Rechnung einbeziehen müssen. Auch das ist nicht geschehen.
Die Pensionskassen können nicht auf die vergangenen Renditeerträge abstellen. Dieses Geld ist ja schon längst ausgegeben. Sie müssen Annahmen über die Renditen in der Zukunft treffen. Diese widerspiegeln sich im sogenannten technischen Zins. Aufgrund der gegenwärtigen Tiefzinsphase sind die Renditeerwartungen tief, deshalb haben die Kassen ihren technischen Zins senken müssen.
In den letzten drei Jahren lagen die durchschnittlichen Renditen der Pensionskassen zwischen 6,2 Prozent und 7,4 Prozent pro Jahr – trotz Tiefzinsphase.
In den nächsten Jahren wird ein grosser Teil des Vermögens kaum mehr Rendite bringen. Die Aktienrenditen schwanken stark. Zudem können die Pensionskassen ihre Aktien- und Immobilienanteile nicht beliebig erhöhen. Wenn eine Pensionskasse sicher sein will, dass sie die Renten in Zukunft zahlen kann, muss sie Annahmen über die künftigen Renditen treffen, und zwar zwingend nach dem Vorsichtsprinzip.
Die Pensionskassenbranche klagt seit Jahren über die angeblich schlechte Lage. Doch ihre reale finanzielle Situation verbessert sich von Jahr zu Jahr. Der durchschnittliche Deckungsgrad stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an.
Die Warnungen und die guten Resultate sind kein Widerspruch. Sie basieren auf dem Vorsichtsprinzip. Die Deckungsgrade sind nur deshalb gestiegen, weil die Kassen im überobligatorischen Teil die neuen Renten tiefer angesetzt haben, weil sie Wertschwankungsreserven aufgebaut haben und weil sie die Pensionierungsverluste auf die Versicherten überwälzen.
Die Pensionskasse von fast der Hälfte der Angestellten sind Versicherungsgesellschaften. Für diese lohnt sich das Geschäft mit der 2. Säule. Sie machen jedes Jahr mehrere Hundert Millionen Gewinn. Wie kann man von Pensionierungsverlusten sprechen, wenn viel Geld als Dividende an die Aktionäre abfliesst?
Die faire Verteilung des Gewinns bei den Lebensversicherern ist ein wichtiges Thema, auch für den Bundesrat. Seine Vorlage zur Altersreform sieht vor, dass die Versicherer weniger Gewinn behalten können. Aber auch sie müssen genügend Rückstellungen machen können.
Ihre Studie hat das US-Unternehmen Towers Watson verfasst, das viel Geld mit der Beratung der Pensionskassen verdient. Nach welchen Kriterien wurde es ausgewählt?
Wir schreiben die Studienaufträge aus. Wir haben uns für jene Offerte entschieden, welche die Aufgabe am besten und kompetentesten löst.
Wie viel hat die Studie gekostet?
182 000 Franken. Das ist verhältnismässig wenig. Der Bund kann attraktive Preise aushandeln.
Zur Person
Colette Nova ist Vizedirektorin des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV). Dort leitet die Juristin seit August 2010 das Geschäftsfeld «AHV, Berufliche Vorsorge und EL». Zuvor war Nova von 1995 bis 2010 geschäftsführende Sekretärin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund und Vizepräsidentin der Suva.
Prognosen statt Fakten
Die Studie des Bundesamts basiert auf Prognosen statt auf konkreten Zahlen.
Die «Aargauer Zeitung» titelte im Mai alarmistisch: «Milliarden fliessen von Jung zu Alt», und zitierte einen Swisscanto-Berater, der von einer Umverteilungssumme von 3,5 Milliarden Franken ausgeht.
Nun hat auch das Bundesamt für Sozialversicherungen eine Studie zum Thema veröffentlicht. Darin wird behauptet, dass jeder neue Rentner zu wenig Kapital gespart habe. Die künftigen Renditen der Kassen seien so tief, dass das Kapital nicht ausreiche, um während zwanzig Jahren eine so hohe Rente wie heute zu bezahlen.
Gerechnet wird mit Worst-Case-Annahmen
Nur: Die Studie basiert auf Zahlen von gerade 27 von rund 2000 Pensionskassen. Und diese Kassen, die Rückstellungen für «Pensionierungsverluste» machen, rechnen nicht mit konkreten Zahlen ihrer Versicherten, sondern mit Prognosen. Die Lebenserwartung wird höher eingesetzt und die Renditen weit tiefer, als die effektiven Zahlen belegen. Sprich: Aus den Rückstellungen für «Pensionierungsverluste» könnten für die Kassen Pensionierungsgewinne resultieren.
Trotz dieser Worst-Case-Annahmen ergab die Studie des Bundesamts nur «Pensionierungsverluste» zwischen 0,1 und 0,2 Prozent des Vermögens. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Vermögensverwaltungskosten und Verwaltungskosten liegen bei 0,82 Prozent, wie zwei andere Studien des Bundesamts zeigen. Jährlich müssen die Versicherten deshalb zwischen 3 und 4 Milliarden Franken für die Verwaltung ihrer Vermögen bezahlen (saldo 2/15). Mit andern Worten: Die Aktiven zahlen nicht für die Pensionierten – das Geld der Jungen und Alten geht in gigantischem Ausmass an Banken und Pensionskassenberater.
Zum Vergleich: Die AHV weist für das Jahr 2013 Vermögensverwaltungs- und Verwaltungskosten von 0,12 Prozent aus – achtmal weniger als bei den Pensionskassen. Ex-Preisüberwacher Rudolf Strahm kritisierte deshalb schon vor fünf Jahren, die Pensionskassen seien zu Selbstbedienungsläden der Berater- und Vermögensverwalterszene verkommen.
Interview: Yves Demuth, René Schuhmacher