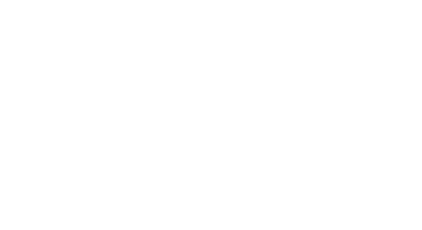Vor vier Jahren nahm Postauto in Sitten «die weltweit ersten selbstfahrenden Busse im öffentlichen Verkehr in Betrieb». Seither gab es auch Versuche in Bern, Marly FR, Meyrin GE, Neuhausen SH und Zug. Das Bundesamt für Strassen schrieb begeistert: «Die Schweiz hat weltweit einen Spitzenplatz.» Und die Postauto-Verantwortlichen platzten fast vor Stolz: «Die Busse werden von Fachbesuchern aus aller Welt besucht.»
Notstopps sind eine Gefahr
Doch zur Euphorie gibt es keinen Grund. Denn eigentlich fahren die Busse gar nicht von allein. Dazu sind sie zu unzuverlässig. Deshalb fährt immer ein Aufpasser mit. Er greift im Notfall ein. Beim ersten Postauto-Pilotversuch war das zwei Mal pro Kilometer nötig. Das geht aus den Berichten zu den Versuchen hervor. Der K-Tipp hat die 731 Seiten durchgelesen. Fazit: Die Busse sind unbrauchbar.
Die Busse stoppen plötzlich – etwa bei starkem Regen, bei Schneefall, bei Wind, vor Pfützen, wenn Laub durch die Luft fliegt, wenn Hecken wuchern, ja sogar vor Mückenschwärmen. In Bern kennen die Angestellten des Tiefbauamts die Probleme. Deshalb «unterbrechen sie freundlicherweise während der Vorbeifahrt des Busses das Laubblasen».
Die zuweilen ruppige Fahrweise und die Notstopps sind eine Gefahr für die Passagiere. Bernmobil schreibt: «Die Fahrgäste müssen sich setzen oder gut festhalten.» Und: «Es gab Fälle, in denen ein Fahrgast wegen eines Notstopps vom Holzsitz rutschte.»
Dabei ist etwa der Bus in der Berner Matte im Durchschnitt mit bloss sechs Kilometern pro Stunde unterwegs. Kein Wunder also, dass ihn die Berner «Matte- Schnägg» nennen.
Der Bus ist so langsam, dass ihn ständig Velofahrer überholen. Und wenn diese ein bisschen knapp einschwenken, dann macht der Bus einen Nothalt. In Sitten «amüsierten sich Fussgänger, indem sie das Verhalten des Busses testeten und ihn stoppten».
Tafel mit Fussgängern verwechselt
Das Hauptproblem ist aber ein anderes. Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen schreiben: «Der Bus unterscheidet nicht zwischen einem lebenden und einem statischen Objekt.» Das heisst: Der Bus hält vor Fussgängern, die am Strassenrand stehen, ebenso wie vor einer Signaltafel. Denn: «Beide Objekte werden als vortrittsberechtigt angesehen.»
Die Sonne als Hindernis
Auch mit einem Stau oder mit einem anderen Bus, der bereits in der Haltestelle steht, kann der Bus nicht umgehen. Die Aufpasser müssen eingreifen. Sonst würde er «den stehenden Bus so lange anhupen, bis dieser losgefahren ist».
Beim Bärenpark in Bern erkennt der Bus die tiefstehende Sonne als Hindernis und hält an. An einer Steigung in Sitten braucht er 7 Sekunden, bis er bei Grün losfährt. Und wenn das Lichtsignal im letzten Moment auf Orange wechselt, dann hält er an. «Mitten auf der Kreuzung», wie es im Postauto-Bericht dazu heisst.
Damit die Busse «wissen», wo sie fahren müssen, wird die Strecke genau programmiert. Sie fahren wie auf Schienen. Was allerdings zu Problemen führen kann. «Mit jeder Runde», heisst es in Schaffhausen, «belastet der Bus immer die gleiche Fahrspur, was sichtbare Risse im Boden verursacht». Kommt hinzu, dass das innere Rad in engen Kurven eigentlich stärker einschlagen müsste als das äussere. Doch das ist nicht der Fall. Deshalb schiebt das äussere Rad über den Belag. Die Folge: zusätzliche Asphaltschäden.
Kurze Lebensdauer
Es ist nicht erstaunlich, dass es mit den Fahrzeugen auch mechanische Probleme gibt. Denn die Fabrikanten sind nicht traditionelle Fahrzeughersteller. Der Gründer von Navya baute einst eine Videospielfirma auf. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Aufpasser nicht Lenkrad und Pedale bedienen, sondern ein Gamepad, wie man es von Computerspielen kennt.
Die mechanischen Probleme sind offenbar enorm. Die Postauto-Verantwortlichen befürchten, dass ihre Busse das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben – nach nur vier Jahren und 11 500 Kilometern. Normale Postautos werden nach zwölf Jahren und einer Million Kilometer verkauft und fahren anderswo weiter.
Aufwendige Reparaturen
Selbst wenn die Busse noch fahrtüchtig sind, ist jede kleine Panne ein Problem. In Bern müssen sie verladen werden. Denn die Werkstatt ist von der Teststrecke «zwei Kilometer entfernt. Und der Weg führt über vielbefahrene Hauptachsen». Beim SBB-Bus in Zug wurden «sämtliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten» von Angestellten des Herstellers ausgeführt. Und diese «flogen bei jedem Ereignisfall aus Toulouse ein».
Was lustig klingt, ist manchmal gefährlich: Der SBB-Bus in Zug liess sich von stark wachsenden Pflanzen durcheinanderbringen. Er fuhr nur noch mit drei Kilometern pro Stunde. «Diese Geschwindigkeit war zu gering, als dass er den Anstieg Flurweg hätte bewältigen können. Er schaltete sich ab und rollte rückwärts. Das war kritisch, weil Schüler nahe am Bus vorbeigingen.»
Zwar ist immer wieder von «künstlicher Intelligenz» die Rede – aber die Busse können nicht lernen. Die Schaffhauser Verkehrsbetriebe schreiben: «Der Bus macht in den gleichen Situationen die gleichen Fehler.» Er erkenne ein Werbeschild am Strassenrand als Hindernis. Deshalb halte er an. Auf jeder Runde von neuem.
Die Busse verursachten auch schon Unfälle. Im Postauto-Bericht ist zwar nur die Rede von einem «Vorfall» in Sitten, der dazu geführt habe, dass die Busse «für zwei Wochen aus dem Verkehr gezogen» werden mussten. In Tat und Wahrheit rammte ein Bus einen Lieferwagen mit offener Heckklappe.
In Schaffhausen fuhr ein Bus eine Elektrovelofahrerin an, sodass sie ins Spital eingeliefert werden musste. Aus der Unfallskizze geht hervor, dass die Frau auf einer Hauptstrasse fuhr und der Bus aus einer Nebenstrasse einbog.
Die Macken der Busse nerven offenbar gewaltig: Bernmobil berichtet von Tagen mit «extrem vielen unnötigen Notstopps – bis zu zehn in 30 Minuten». Deshalb brauche das Personal «mehr Konzentration als auf einer Bus- oder Tramlinie in der Altstadt». Und das will etwas heissen.
Stolze Beträge der öffentlichen Hand
Der K-Tipp wollte von den ÖV-Unternehmen wissen, bis wann die Busse tatsächlich selbst fahren könnten. Die Antworten waren vage. Aber in den nächsten zehn Jahren rechnet niemand damit.
Statt Forschung und Entwicklung den Herstellern zu überlassen, engagieren sich Transportunternehmen und die öffentliche Hand trotzdem schon jetzt – mit stolzen Beträgen. Zahlen nennen in ihren Berichten nur die SBB (über 2,7 Millionen Franken) und Bernmobil (1,3 Millionen).
Die Zahlen lassen sich aufgrund der jeweiligen Versuchsdauer und der Anzahl Fahrzeuge hochrechnen: Insgesamt kommen so 20 Millionen Franken zusammen.
Doch die Busse rechnen sich nicht. Bernmobil lässt die Passagiere gratis mitfahren, weil «der Betrieb nicht garantiert werden kann». Die Zahlen der SBB zeigen, dass im ersten Jahr zur Deckung der Betriebskosten auf jeder Fahrt 25 Passagiere hätten mitfahren müssen – bei einem Angebot von 8 Plätzen.