Inhalt
04.10.2011
Die Schweizer Reisebranche gibt sich empört. Seit Monaten. Man verfüge im Wettbewerb mit ausländischen Online-Anbietern nicht über gleich lange Spiesse und verliere deshalb viele Kunden, echauffierten sich Vertreter des Reisebüroverbands und von Veranstaltern wiederholt in der Fachpresse. Denn das Schweizer Recht verpflichte einheimische Anbieter, die Reisen in Franken auszuschreiben, wäh- rend «Ausländer» selbst auf Websites mit «.ch»-Endung in Euros anbieten dürften.
Bloss: Was änderte sich denn, wenn Letztere ihre Reisepreise in der Schweiz in Franken statt in Euros angeben müssten? Nichts, sofern zu tagesaktuellen Kursen umgerechnet würde. Die Differenz zu den höheren Preisen der Schweizer Veranstalter bliebe bestehen – sie würde gar noch deutlicher sichtbar.
Und diese Differenz ist keineswegs nur auf den Kurszerfall des Euros zurückzuführen. Denn gerade dank des starken Frankens kaufen Schweizer Veranstalter ihre Reisebausteine im Ausland ja seit geraumer Zeit auch günstig ein. Und niemand verbietet ihnen, Einkaufsvorteile an ihre Kunden weiterzugeben.
Sie könnten zum Beispiel die Verkaufspreise auf ihren Internetseiten sofort reduzieren, wenn sie von sinkenden Kosten für Kontingente in Hotels, Flugzeugen oder Mietautoflotten profitiert haben. Für die gedruckten Kataloge könnten sie aktualisierte Preislisten nachliefern. Oder sie könnten in den Katalogen darauf hinweisen, dass Buchungen zu tagesaktuellen Preisen möglich sind.
Das Lamento über die «ungleichen Spiesse» wirkt daher aufgesetzt. Die Schweizer Reisebranche könnte einiges zur Angleichung der Spiesse tun. Die ausländische Konkurrenz auf ihr hohes Preisniveau zwingen, das kann sie allerdings nicht. Zum Glück für die Konsumenten.
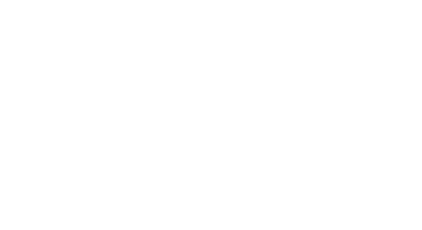






Kommentare zu diesem Artikel
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar hinzuzufügen
Sind Sie bereits Abonnent, dann melden Sie sich bitte an.
Nichtabonnenten können sich kostenlos registrieren.
Besten Dank für Ihre Registration
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung Ihrer Registration.
Keine Kommentare vorhanden