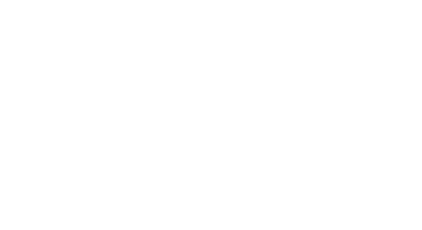Der Branchenverband Proviande wirbt auf seiner Internetseite für Fleisch aus Schweizer Produktion. Eines der Argumente: Hormone seien bei Schweizer Nutztieren verboten. Doch das stimmt so nicht: Laut der Datenbank des Heilmittelinstituts Swissmedic sind in der Schweiz allein für Schweine mehr als 15 verschiedene Hormonpräparate zugelassen. Sie wirken auf den Sexualzyklus der Tiere, gelten aber laut Gesetz nicht als hormonelle Leistungsförderer zwecks schnellerer Mast. Diese sind in der Schweiz wie in der EU verboten.
Der Unterschied besteht laut Bundesamt für Veterinärwesen vor allem in der Anwendungsdauer: Leistungsförderer werden über eine längere Zeit eingesetzt, während Sexualhormone nur punktuell angewendet werden und im Körper der Tiere nach kurzer Zeit nicht mehr nachweisbar sind.
Schweinezüchter können auf Verschreibung durch einen Tierarzt bestimmte Sexualhormone einsetzen, um bei Sauen die Brunst auszulösen. Das optimiert den Betriebsablauf: Die Tiere können zur gleichen Zeit besamt werden, und sie ferkeln nach einer Tragzeit von 115 Tagen gleichzeitig ab, wie es im Fachjargon heisst. Zahlen zur Menge der verwendeten Hormone kennen weder die Gesellschaft der Schweizer Tierärzte noch das Bundesamt. Der Einsatz der Mittel wird nicht zentral erfasst.
Schweine ohne Nachwuchs sind unrentabel
Der Verband der Schweineproduzenten Suisseporcs schätzt, dass die Züchter solche Hormone bei rund zehn Prozent der Sauen einsetzen, sofern «Zyklusstörungen» auftreten. Als Störung gelte zum Beispiel, wenn eine Sau nach dem Absetzen der Ferkel nicht wieder paarungsbereit werde. Suisseporcs-Geschäftsführer Felix Grob: «Ohne die Hilfe von Hormonen müssten Sauen mit Zyklusproblemen geschlachtet werden.» Fakt ist: Sie rentieren für den Halter nicht.
Auch die Geburt wird teilweise hormonell beeinflusst: Hat die Sau zum geplanten Zeitpunkt noch keine Ferkel geworfen, kann die Geburt mit Hilfe des Hormons Prostaglandin eingeleitet werden. Tierarzt Felix Goldinger von der Vereinigung für Schweinemedizin erklärt: «Gerade bei jungen Sauen ist die Geburtseinleitung angebracht. Sonst sind die Ferkel bei der Geburt zu gross.» Der Tierarzt schätzt den Einsatz in der Schweiz auf etwa zehn Prozent. Noch häufiger wird nach seiner Erfahrung das Hormon Oxytocin zur Beschleunigung der Geburt verwendet.
25 Hormonpräparate für Rinder
In der Rinderzucht werden ebenfalls Sexualhormone verwendet. Über 25 verschiedene Präparate sind für Rinder zugelassen. Sie dienen wie bei den Schweinen der Steuerung von Paarungsbereitschaft, Wehen und Geburt der Tiere (K-Tipp 4/2014). Barbara Früh vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau kritisiert: «Die Tiere werden mit Hilfe von Sexualhormonen an die wirtschaftlichen Bedingungen der intensiven Haltung angepasst.» Bei Schweinen zum Beispiel lasse sich der Zyklus auch mit natürlichen Mitteln wie dem Besuch vom Eber oder besonders energiereichem Futter anregen. Die Richtlinien von Bio Suisse verbieten den Einsatz von Hormonen zur Steuerung der Fortpflanzung. Sie sind aber erlaubt für medizinisch notwendige Therapien.
Proviande gibt zu: Der Satz über das angebliche Verbot von Hormonen auf der Internetseite des Verbands sei missverständlich formuliert. Tatsächlich seien damit nur Hormone zur Leistungsförderung gemeint. Proviande verspricht, den Text «anzupassen». �
Skandal um Stutenhormon
2015 zeigte der «Kassensturz» einen schockierenden Beitrag: Das Stutenhormon PMSG zur Behandlung von Muttersauen wird teilweise unter tierquälerischen Bedingungen auf Farmen in Südamerika hergestellt. Die Stuten produzieren das Hormon nur in den ersten Wochen der Trächtigkeit. In dieser Zeit werden ihnen wöchentlich grosse Mengen Blut abgenommen. Danach werden die Fohlen auf brutale Weise abgetrieben. Die Stuten werden erneut gedeckt.
In der Schweiz vertreibt die Firma MSD Animal Health zwei Präparate mit dem Hormon. Rund zehn Prozent der Schweinezüchter verwendeten es laut «Kassensturz» zum Auslösen der Brunst bei Sauen.
In einer Stellungnahme des Bundesrats vom November 2016 heisst es, der Einsatz von PMSG sei seit dem Beitrag um rund 80 Prozent zurückgegangen.