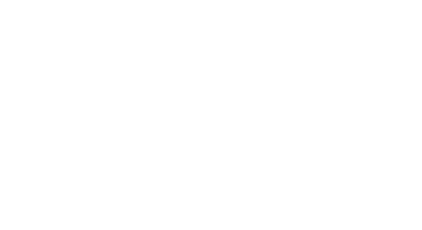Die mittlere Lebenserwartung eines deutschen Mannes im Niedriglohnsektor beträgt 70,1 Jahre, in der höchsten Einkommenskategorie 80,9 Jahre. Das ist ein Unterschied von 10,8 Jahren. Bei den Frauen beträgt die Differenz 8,4 Jahre. Das zeigt der Datenreport 2013, ein umfangreicher Bericht über die sozialen Verhältnisse in Deutschland. Daraus wird klar: Wer wenig verdient, ist früher tot. Die Gründe sind hohe Arbeitsbelastung, Schichtbetrieb und schlechte Ernährung.
In der Schweiz gibt es offiziell keine Daten, welche die Lebenserwartung nach Lohnklassen aufschlüsseln. Ein vom Bundesamt für Sozialversicherungen in Auftrag gegebenes Forschungsprojekt der Uni Genf zeigt immerhin gewisse berufsbedingte Unterschiede: So sterben 15 Prozent aller männlichen Angestellten im Gastgewerbe vor Erreichen des Pensionsalters, bei Lehrern und Architekten sind es nur 7 Prozent (saldo 19/13).
Studie: Abgänger von Hochschulen leben länger
Für die Altersrente der Pensionskasse von Bedeutung ist die Lebenserwartung ab dem Rentenalter. Die Genfer Studie gibt dazu keine Antwort aufgrund von Beruf oder beruflicher Stellung der Pensionierten. Sie hat aber die Rentner nach ihrer Ausbildung analysiert. Auch dies gibt Hinweise auf die Lebenserwartung der sozialen Schichten.
Das Ergebnis: 65-jährige Schweizer Männer mit obligatorischem Schulabschluss, aber keiner weiteren Ausbildung, haben eine Restlebenserwartung von 16,1 Jahren. Männer mit einem Abschluss an einer Uni, einer Fachhochschule oder einer höheren Fachschule leben noch 18,7 Jahre – 2,6 Jahre länger. 65-jährige Frauen mit einer höheren Ausbildung kommen auf eine Restlebenszeit von 22,4 Jahren und übertrumpfen damit ihre Geschlechtsgenossinnen mit obligatorischer Schulbildung um 2,1 Jahre.
Die Pensionskassen selbst verfügen angeblich über keine Daten zur Lebenserwartung ihrer Rentnerinnen und Rentner, abhängig von Bildungsstand, Lohn oder Beruf. Für die Berechnung des Todesfallrisikos verwenden sie meist die Sterbetafeln BVG 2010 oder VZ 2010. Laut Hans Peter Konrad, Direktor des Pensionskassenverbandes Asip, decken sie «unterschiedliche Branchen und Regionen ab und zeigen ein realistisches Bild der Lebenserwartung».
Das stimmt nicht: Denn BVG 2010 enthält die Daten von 14 grossen Pensionskassen, darunter jene von Migros, Ciba, CS, UBS, SBB und Swiss Re. Und die Sterbetafeln VZ 2010 basieren auf den Daten von 21 Pensionskassen von Bund, Kantonen und Gemeinden.
Sprich: Staatsangestellte und Leute aus dem Dienstleistungssektor sind bei den Sterbetafeln massiv übervertreten. Sie leben dank guter Arbeitsbedingungen und relativ hoher Löhne länger als Leute, die 45 Jahre lang körperlich gearbeitet haben.
Diese einseitigen Daten zur Lebenserwartung benutzen Pensionskassen, Versicherungen und Bundesrat aber immer wieder, um die Senkung der Altersrenten zu begründen. Zurzeit muss das obligatorische Altersguthaben bei der Pensionierung mit einem Umwandlungssatz von 6,8 in eine Rente umgerechnet werden. Das heisst: Pro 100 000 Franken Alterskapital müssen die Kassen jährlich 6800 Franken Rente zahlen. Künftig sollen es nach Meinung von Pensionskassen und Bundesrat nur noch 6400 Franken oder noch weniger sein. Das Argument: Die Lebenserwartung steige ständig. Doch das ist bei den Frauen laut den Zahlen des Bundesamts für Statistik kaum mehr der Fall. Für Deutschland zeigen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung, dass die Lebenserwartung der Angestellten in niedrigen Einkommensgruppen gar abgenommen hat – von 2001 bis 2010 um zwei Jahre. Zahlen für die Schweiz gibt es nicht.
Von den frühen Todesfällen profitieren die Pensionskassen
Da Tieflöhner und wenig Gebildete früher sterben, brauchen sie ihr gespartes Alterskapital nicht auf. Bei Ledigen können die Pensionskassen in solchen Fällen das restliche Geld behalten; bei Verheirateten zumindest einen Teil, weil der überlebende Ehepartner noch eine Teilrente erhält.
Davon profitieren nicht nur die Pensionskassen, sondern auch jene, die eine Rente beziehen und länger leben als der Durchschnitt. Sie werden indirekt von den wenig Qualifizierten in den Pensionskassen «subventioniert».
Fairer wäre es deshalb, wenn der Umwandlungssatz ans Bildungsniveau oder Einkommen angepasst würde. So würden die Rentenleistungen der unterschiedlichen Lebenserwartung eher entsprechen.
Der Pensionskassenverband hält nichts von dieser Idee. Er argumentiert: Würde der Umwandlungssatz so festgelegt, müssten diverse Kassen mit verschiedenen Versichertengruppen unterschiedliche Umwandlungssätze anwenden. «Das würde die Transparenz und Verständlichkeit der beruflichen Vorsorge klar verschlechtern.» Laut Bundesamt für Sozialversicherungen sind viele Kassen zu klein. Gesetzmässigkeiten, die für die Gesamtheit der Bevölkerung gelten, würden auf kleine Kassen nicht zutreffen. Den Umwandlungssatz aufgrund allgemeiner Grundlagen zu differenzieren, sei deshalb «gefährlich». Zudem hätten Pensionskassen schon heute die Möglichkeit, den Umwandlungssatz zu erhöhen, falls ihre Rentner im Durchschnitt weniger lang leben als angenommen.
Doris Bianchi vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund kritisiert, dass es keine statistischen Daten über die Pensionskassenguthaben gibt, die nach Lohnklassen aufgeschlüsselt sind. Sie fordert: «Die unterschiedliche Lebenserwartung nach Bildungsstand muss bei der Festlegung des Mindestumwandlungssatzes berücksichtigt werden.»