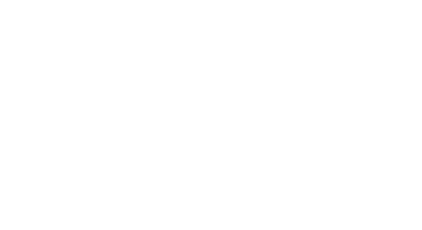Das Geschäft mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung floriert. Ende 2012 betrug das Eigenkapital aller Kassen in der Grundversicherung über 12 Milliarden Franken. Zwei Jahre vorher waren es laut den Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherung 8,6 Milliarden. Gut 60 private Krankenkassen teilen sich das Geschäft. Wer in der Schweiz wohnt, muss sich zwingend bei einer der Kassen versichern. Die Leistungen sind für alle gleich. Unterschiedlich sind nur die Prämien (K-Tipp 14/14).
Das Gesetz verpflichtet die Krankenkassen, Reserven anzulegen. Damit soll verhindert werden, dass die Privatunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Dieses finanzielle Polster, für das die Prämienzahler aufkommen müssen, wird von Jahr zu Jahr dicker. Dies einerseits aufgrund von neuen Vorschriften. Andererseits legen die Krankenkassen mehr Reserven zur Seite, als sie gesetzlich müssten («Saldo» 12/12). Nach geltendem Recht gibt es nämlich keine Höchstgrenze.
Die konkreten Zahlen: Im Jahr 2002 lagen bei den Krankenkassen noch 1,9 Milliarden Franken auf der hohen Kante, zehn Jahre später waren es bereits 6,5 Milliarden. Das zeigt: Die obligatorisch Versicherten zahlen Prämien auf Vor-rat. Sie berappen nicht nur die laufenden Kosten für Ärzte, Spitäler, Apotheken und die Verwaltungskosten der Kassen. Sie müssen den Versicherungen auch noch eine Kapital- und Reservendecke finanzieren.
Jahrelang gegen Rückzahlungen
Zu viel eingenommene Gelder geben die Kassen ungern zurück. Das zeigt das Trauerspiel um die kantonalen Reservetöpfe. Die Prämienzahler insbesondere der Kantone BS, NE, GE, TI, TG, VD und ZH zahlten in den letzten Jahren im Verhältnis zu den bezogenen Leistungen zu hohe Prämien. Mehrere Jahre hat das Parlament über die Rückzahlung dieser Gelder an die Prämienzahler diskutiert – bis endlich am 12. September eine Verordnung verabschiedet wurde, die zumindest eine Teilkorrektur ermöglicht: Den Versicherten der Kantone ZH, ZG, FR, AI, GR, TG, TI, VD und GE werden von 2015 bis 2017 total 800 Millionen Franken zurückerstattet. Finanziert wird die Rückzahlung vom Bund, den Krankenkassen und den Prämienzahlern der Kantone, die zu wenig bezahlt haben. Die Krankenkassen müssen ihren Beitrag grundsätzlich aus den Reserven finanzieren. Falls die nicht ausreichen, dürfen die Kassen einen Einmalzuschlag auf die Prämien machen.
Erfolgreiches Lobbyieren
Mit einem Aufsichtsgesetz möchte der Bundesrat Prämien und Reserven der Kassen besser kontrollieren. Die ins Parlament geschickte Vorlage sieht vor: Prämien, die zu übermässigen Reserven führen, werden nicht genehmigt. Der Bundesrat möchte zudem, dass zu viel bezahlte Prämien zurückerstattet werden müssen.
Das passt den Kassen nicht. Nach eifrigem Lobbying ihrer Vertreter hat der Nationalrat am 9. September die Vorlage des Bundesrats in mehrfacher Hinsicht abgeschwächt:
- Statt umfassender Kontroll- und Weisungsbefugnisse soll das Bundesamt für Gesundheit lediglich Einsichtsrechte erhalten.
- Die Kassen sollen selber entscheiden, ob sie zu viel bezahlte Prämien im Folgejahr zurückerstatten.
Die Abstimmung am 28. September über die Einführung einer öffentlichen Kasse für die obligatorische Krankenversicherung hätte auch Folgen für die Prämien. Kantonale Agenturen würden diese anhand der Kosten festlegen. Heute legen die Kassen die Prämien jährlich im Voraus aufgrund von Kostenprognosen fest. Mit den Reserven werden angeblich auch Schätzungsfehler ausgeglichen. Eine Einheitskasse könnte die Kosten einfacher voraussagen, weil alle Personen bei ihr versichert wären – die «guten» wie die «schlechten» Risiken.
Zu viel kassierte Gelder würden den Prämien zugutekommen. Denn eine öffentliche Kasse müsste weder Eigenkapital noch hohe Reserven aufbauen, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Es bestünde im Rahmen der Grundversicherung kein Risiko mehr, dass eine schlecht wirtschaftende private Kasse zahlungsunfähig wird.