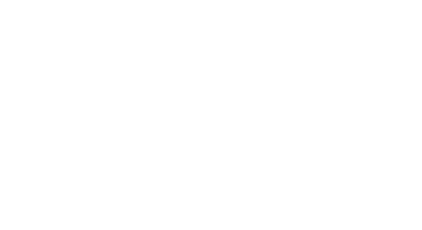Wer in einem Spital in der Schweiz wegen eines Kaiserschnitts oder Bandscheibenvorfalls unters Messer kommt, kann nie sicher sein, ob die Operation wirklich nötig ist. Grund: Je mehr solche Eingriffe, desto lukrativer für das Spital. Davon profitieren auch die leitenden Spitalärzte.
Laut einer Umfrage des Ärzteverbands FMH erhielt im Jahr 2012 jeder fünfte Chefarzt oder leitende Arzt an Schweizer Akutspitälern einen Bonus. Die Boni machen bei Chefärzten durchschnittlich 20 Prozent des Gesamtlohnes aus, bei leitenden Ärzten rund 25 Prozent. Laut dem Verein der leitenden Spitalärzte der Schweiz nehmen Boni-Verträge seit zwei Jahren zu – vor allem in Kantons- und Bezirksspitälern. Überdies kassieren viele Spitalärzte Extrahonorare für Privatpatienten.
Deutsche Spitäler müssen Ärzteboni künftig offenlegen
Das Problem: Der einzelne Patient erfährt nie, welche Zuschläge der leitende Arzt kassiert, wenn sein Spital oder seine Abteilung mehr Eingriffe oder Untersuchungen durchführt als bisher.
In deutschen Spitälern soll mit der Heimlichtuerei nun Schluss sein. Patienten haben künftig Anspruch auf Auskunft darüber, ob der Chefarzt einer Klinik einen Bonus dafür erhält, dass er besonders viele Patienten operieren lässt. Deutsche Spitäler müssen ab sofort im Geschäftsbericht offenlegen, welche umsatz- und mengenabhängigen Zulagen sie ihren Chefmedizinern zahlen. Das hat der Bundesausschuss von Ärzten, Spitälern und Krankenkassen Ende März beschlossen. Fehlbaren Spitälern drohen Bussen von Zehntausenden von Franken. Das Ziel: Patienten sollen sich so besser vor unnötigen Operationen schützen können.
Anders in der Schweiz: Bund und Kantone kennen keine Regeln für Boni von leitenden Spitalärzten, obwohl Prämien- und Steuerzahler diese finanzieren müssen. saldo fragte bei den Betreibern von 20 Spitälern nach. Keines legt konkrete Vorgaben und den Anteil der Boni am Gesamtlohn der Chefärzte offen.
Die meisten Spitalverantwortlichen äussern sich nur allgemein: Die private Hirslanden-Gruppe gibt an, Ärzten in ihren 14 Spitälern Boni nur «ausnahmsweise» und für «klar definierte, unternehmerische Jahres- und Projektziele» zu zahlen. Das Spital Thun räumt ein, an den «Klinikerfolg» gekoppelte Lohnanteile auszuschütten. Das Spital Zug zahlt Boni, wenn Ärzte «quantitative und qualitative Kriterien» erfüllen.
Patienten- und Konsumentenschützer, der Ärzteverband FMH und der Verein der leitenden Spitalärzte verlangen hingegen den Verzicht auf Boni-Verträge für leitende Spitalärzte. Die Boni setzen laut FMH «Fehlanreize». Diese können dazu führen, dass Spitäler mehr unnötige Behandlungen durchführen oder andere «schwer messbare Aufgaben» vernachlässigen.
«Finanzielle Anreize» haben grossen Einfluss auf die Behandlung
Der Bund verfügt nach eigenen Angaben über keine verlässlichen Zahlen zu den Vergütungen. Der Gesundheitsökonom Gianfranco Domenighetti, Professor an der Uni in Lugano, kritisiert das «geringe Interesse am Thema der Unter- und Überversorgung im Schweizer Gesundheitssystem». Für ihn ist klar, dass «finanzielle Anreize» die Behandlung der Patienten beeinflussen. Beispiele:
- Kaiserschnitte: Laut dem Gesundheitsobservatorium Obsan kommt jedes dritte Kind in Schweizer Spitälern per Kaiserschnitt zur Welt. Im Kanton Zug sind es 40 Prozent, in Solothurn, Basel und Nidwalden rund 36, im Jura 18,6 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält eine Quote von 10 bis 15 Prozent für medizinisch gerechtfertigt.
- Kniegelenke: 212 Patienten pro 100 000 Einwohner erhielten in der Schweiz im Jahr 2010 ein künstliches Kniegelenk. Laut OECD ist das die zweithöchste Rate in Europa nach Deutschland. Der EU-Durchschnitt lag bei 109 Eingriffen. Patienten aus den Kantonen Glarus und St. Gallen bekamen fast zweieinhalbmal häufiger eine Knieprothese als Patienten aus dem Jura.
- Regionale Unterschiede auch bei andern Eingriffen: Patienten aus Graubünden kamen 2,3 Mal so oft wegen eines Bandscheibenvorfalls unters Messer wie Patienten aus dem Kanton Luzern. Herzpatienten aus Basel oder dem Tessin erhielten über dreimal häufiger einen Bypass als Patienten aus dem Kanton Genf.
- Lukrative Privatpatienten: Wer privat versichert ist, wird eher häufiger operiert als andere Patienten. Laut Domenighetti wird privatversicherten Patientinnen die Gebärmutter mit einer 50 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit entfernt als Frauen ohne Spitalzusatz. Privatversicherten wird auch 42 Prozent häufiger der Blinddarm operiert. An Privatversicherten verdienen Ärzte und Spitäler mehr als an Grundversicherten.
Um sich vor unnötigen Eingriffen zu schützen, empfiehlt Domenighetti, «eine zweite medizinische Meinung einzuholen – ohne dem Arzt den Zweck des Besuches zu nennen»w.