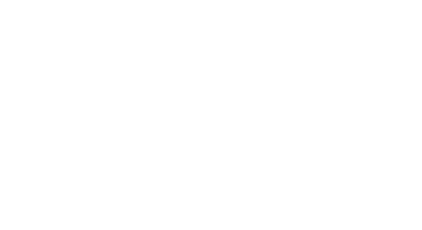Verschiedene Chemikalien sorgen in Autoreifen dafür, dass diese bei Kälte, Hitze und Nässe gut funktionieren. Durch die Abnutzung der Pneus beim Fahren entsteht Gummistaub. Laut dem Schweizerischen Ökotoxzentrum fallen jedes Jahr allein in der Schweiz mindestens 10'000 Tonnen Reifenabrieb an. Der Staub gelangt über den Regen und den Wind auf die Felder.
Erstmals zeigen nun Messungen des K-Tipp: Salate und weitere Pflanzen nehmen die Chemikalien aus den Autoreifen über ihre Wurzeln auf. Die Rückstände aus dem Reifenabrieb landen so auch in der Salatschüssel. Für den Test hatte der K-Tipp bei Schweizer Grossverteilern unter anderem Nüsslisalat, Rucola und Kopfsalat eingekauft und in ein Wiener Labor geschickt. Das auf Umweltbelastungen spezialisierte Team analysierte die Produkte auf Chemikalien, die typischerweise in Pneus vorkommen.
Ergebnis: 12 von 15 untersuchten Salaten enthielten Rückstände von Gummistaub. Jedes Produkt wurde mehrfach analysiert: Am meisten Chemikalienrückstände fand das Labor in Kopfsalat, Rucola und Babyspinat aus Italien. Die gemessenen Höchstwerte lagen zwischen 59 und 104 Nanogramm pro Gramm Salat.
Neun weitere Salate aus der Schweiz sowie aus Italien und Spanien waren ebenfalls mit Pneuchemikalien belastet – allerdings in kleineren Mengen, nämlich von 0,1 bis 45,9 Nanogramm pro Gramm Salat. Nur in drei Salaten aus den genannten drei Ländern fand das Labor keine Rückstände von Autopneus.
Thilo Hofmann ist Leiter der Forschungsplattform «Plastik in der Umwelt und Gesellschaft» der Universität Wien.Er zeigt sich überrascht über die deutlichen Resultate – und darüber, dass die Stoffe in Salaten aus Supermärkten zu finden waren. «Das hätte ich nicht vermutet», sagt Hofmann. Untersuchungen seines Forscherteams hatten im Jahr 2022 gezeigt, dass Pflanzen bei Laborbedingungen über ihr Wurzelwerk Chemikalien aus Mikroplastik aufnehmen können.
Risiken weitgehend unerforscht
Noch ist wissenschaftlich nicht untersucht, wie sich die Aufnahme derartiger Rückstände von heiklen Stoffen langfristig auf die Gesundheit auswirkt. Beunruhigend: Fast alle der in den Salaten gefundenen Substanzen gelten als allergieauslösend und langfristig schädlich für die Umwelt. Einzelne Substanzen stehen ausserdem im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen oder die Fruchtbarkeit zu schädigen.
Nicht nur Reifenabrieb belasten Mensch und Umwelt. Auch Mikroplastik aus Polyethylen, PET und Styropor gelangt in grossen Mengen auf die Felder. In einer Untersuchung des K-Tipp von Ackerböden in der Schweiz zeigte sich vor einem Jahr: Alle Bodenproben waren mit Mikroplastik belastet (K-Tipp 17/2022). In einem Kilo Humus aus dem Kanton Thurgau fand das Labor mehr als 100'000 Kunststoffteilchen. Auch diese Schadstoffe können in die Pflanzen gelangen.
Grossverteiler halten sich bedeckt
Der K-Tipp wollte von den Grossverteilern wissen, ob sie beim Einkauf von Salat darauf achten, dass die Anbaufelder nicht direkt an stark befahrenen Strassen oder Industriearealen liegen. Aldi sagt dazu nur, man richte sich bei der Gemüsebeschaffung nach den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Auch Lidl gibt sich bedeckt: Bei der Auswahl der Anbaugebiete würden verschiedene Kriterien berücksichtigt.
Denner teilt auf Anfrage mit, dass die Nähe der Salatfelder zu Strassen, Siedlungsgebieten oder Industriearealen beim Beschaffen von Gemüse keine Rolle spiele. Migros und Coop schreiben, dass es für die vom Labor gemessenen Schadstoffe keine gesetzlichen Grenzwerte gebe. Die Lage der Salatfelder werde nicht überprüft.
Pflanzen speichern Mikroplastik
Wie erwähnt hatte ein Forscherteam der Universität Wien vergangenes Jahr aufgezeigt, wie Chemikalien aus Gummiabrieb von Reifen in die essbaren Teile von Pflanzen gelangen können. Die Forscher kauften in einem Gartencenter Salatstecklinge. Die jungen Pflanzen wurden von Erde gesäubert und in Gläsern mit Nährlösung in einer Klimakammer aufgezogen.
Die Forscher fütterten einen Teil der Pflanzen mit fünf typischen Chemikalien aus Gummiabrieb. Innerhalb von 14 Tagen ernteten die Labormitarbeiter regelmässig Salatblätter, trockneten sie und untersuchten sie auf Rückstände der Chemikalien. Ergebnis: Alle Pflanzen nahmen die Chemikalien über die Wurzeln auf, transportierten sie in die essbaren Blätter und speicherten sie dort ab.
Das Experiment zeigte ausserdem: In den Salatblättern entstanden aus den Chemikalien zahlreiche andere Stoffe. Darunter fanden sich Substanzen, die für Fische giftig sind, und solche, deren Auswirkungen für die Gesundheit von Mensch und Tier sich noch nicht abschätzen lassen.
Forscher fordern neue Grenzwerte
Laut den Wiener Forschern besteht deshalb die Gefahr, dass gesetzliche Grenzwerte für solche Substanzen zu tief angesetzt werden, wenn die Behörden lediglich von der Menge der Ausgangsstoffe ausgehen. Beim Festlegen von Grenzwerten gelte es in Zukunft zu berücksichtigen, dass Pflanzen Chemikalien aus Mikroplastik speichern und in weitere Stoffe umwandeln.
So hat der K-Tipp getestet
Ein spezialisiertes Forscherteam der Universität Wien untersuchte im Auftrag des K-Tipp 15 Salate aus dem Schweizer Detailhandel auf 17 chemische Stoffe, die typischerweise in Reifenabrieb vorkommen. Jeder Salat wurde mehrfach geprüft. Die Forscher fanden in den Salaten Rückstände der folgenden neun Substanzen:
DPG (1,3-diphenylguanidin): Kommt in der Pneuherstellung als Beschleuniger der Vulkanisation zum Einsatz – dabei wird der Kautschuk durch Hitze und Druck gegen mechanische Beanspruchung widerstandsfähig gemacht. Die Chemikalie steht laut der europäischen Chemikaliendatenbank Echa im Verdacht, die menschliche Fruchtbarkeit zu schädigen. In der Datenbank Rigoletto des deutschen Umweltbundesamtes ist DPG zudem als stark wassergefährdend eingestuft und gilt als giftig für Wasserlebewesen.
IPPD (N-isopropyl-N-phenylenediamin): Schützt schwarzen Gummi vor dem Altern. Gilt laut Echa als sehr giftig für Wasserlebewesen und kann bei Menschen Allergien auslösen.
Benzothiazol: Wird in der Gummiindustrie eingesetzt. Die giftige Chemikalie kann gemäss Echa zu Schäden bei Organen wie der Leber führen, wenn man dem Stoff länger ausgesetzt ist.
2-MBT (2-Mercaptobenzothiazol): Dient bei der Pneuherstellung ebenfalls als Vulkanisationsbeschleuniger und wird von der internationalen Agentur für Krebsforschung als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft. Der Stoff ist laut der Chemikaliendatenbank Echa giftig für Wasserlebewesen und kann Hautallergien auslösen.
HMMM (Hexamethoxymethylmelamin): Ein Mittel zur Verstärkung von Reifen. Der Stoff steht laut einer Studie der
kanadischen Forscherin Cassandra Johannessen im Verdacht, Fische zu schädigen. Gemäss einer Untersuchung von Valerie Wilkeit, Studentin der Umweltwissenschaften an der Uni Wien, stellen die aktuell gemessenen Konzentrationen
von HMMM in der Donau ein «ökotoxikologisches Risiko für Wasserlebewesen» dar.
CPPD (N-phenyl-N-cyclohexyl-p-phenylenediamin): Der Stoff verlangsamt das Altern von Gummi. Er ist laut Echa giftig für Wasserlebewesen – mit anhaltender Wirkung. Zudem kann die Chemikalie Hautallergien auslösen.
NCBA (N-cyclohexyl-2-benzothiazolamin): Kommt fast ausschliesslich in vulkanisiertem Gummi vor. Der Stoff gilt laut einem Bericht der Forschungsanstalt Empa und Studien aus Japan als Anzeichen für Reifenabrieb. Die Substanz kann laut der Datenbank Pubchem des US-Gesundheitsinstitutes zu Irritationen der Atemwege und der Haut führen.
2-Hydroxybenzothiazol: Laut Echa ist der Stoff bei Hautkontakt und beim Schlucken gesundheitsschädlich.
5-methyl-1H-benzotriazol: Wird in der Gummiproduktion eingesetzt. Gilt laut der Datenbank Rigoletto des deutschen Umweltbundesamtes als stark wassergefährdend.